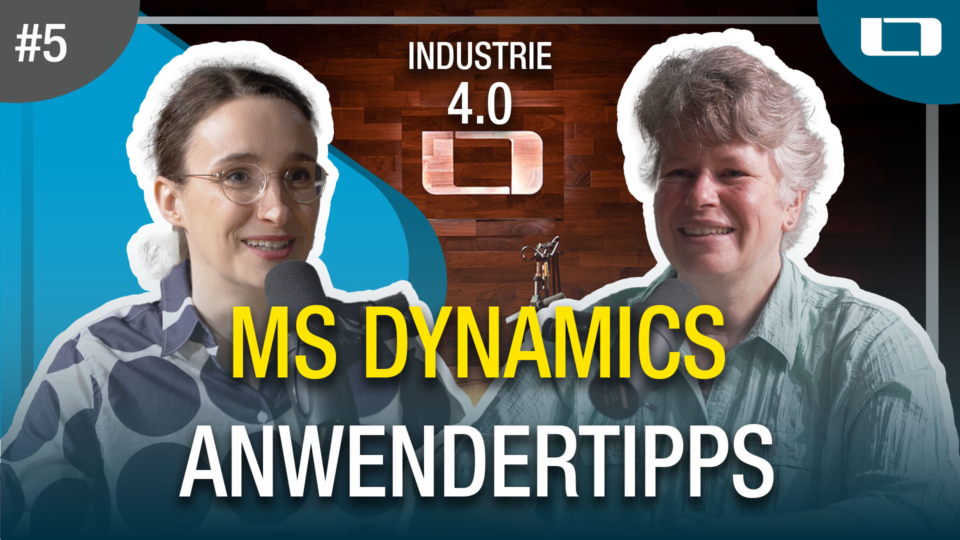ANDREA SPIEGEL: Das heißt, am Ende komme ich vielleicht dann wieder gar nicht um die ganzen Systeme drum herum? Oder wie ist da gerade aktuell, sag ich mal, deine Einschätzung?
CHRISTOPH RIXE: Also, ich glaube nicht, dass es eine Blaupause gibt, mit der man sagen kann: „Das ist der Weg to go und das empfehle ich all meinen Kunden.“ Sondern wir müssen uns tatsächlich angucken, was die Anforderungen des Kunden sind. Brauche ich zwei Systeme? Ja. Kann ich die physisch trennen? Dann kann ich natürlich auch wieder sagen: „Okay, man könnte eine ROI-Berechnung machen und sagen, wenn man nur einen Flottenmanager findet, der beides kann, dann sind die Lizenzkosten so und ihr habt nur einen Ansprechpartner etc.“
Nehmen wir an, wir haben zwei Systeme. Dann kann man sagen, okay, die Lizenzkosten sind vielleicht etwas geringer, aber dafür habt ihr zwei Systeme und braucht zwei Ansprechpartner. Aber das muss man sich im individuellen Use Case anschauen und dann entscheiden, welche dieser Optionen man wählen möchte: einen Flottenmanager, zwei Flottenmanager, nur einer für mehrere Systeme etc. Und im Rahmen einer Analyse vor Ort kommt man relativ schnell auf den richtigen Weg.
ANDREA SPIEGEL: Bist du da bei einem der Projekte, an denen du gerade selbst beteiligt bist, schon mal in die Verlegenheit gekommen, dass das so ein Thema wurde, dass mehrere verschiedene Roboter eingebunden werden mussten? Oder sagst du, der Standard-Use-Case ist eigentlich erstmal ein Hersteller, erstmal Basic-Systeme, und das reicht dann für die nächsten zwei, drei Jahre?
CHRISTOPH RIXE: Nee, da kommen wir schon häufiger hin, dass wir sagen, okay, dafür wäre das eine smarte Lösung, dafür wäre das eine smarte Lösung. Das Problem ist, es sind unterschiedliche Hersteller, da müssen wir uns Gedanken machen: Machen wir zwei Plattformen oder suchen wir uns eine Plattform, die beides kann? Und dann wird es ja nochmal komplizierter, weil diese Plattformen, die mehrere Roboter unterstützen, also das ist eine Schnittstelle – das heißt nicht „Plug and Play“. Es bedeutet nicht, dass nur weil ich jetzt eine VDA 5050-konforme Schnittstelle habe, auch alle fahrerlosen Transportfahrzeuge automatisch funktionieren. Auch diese Hersteller müssen natürlich die Roboter so einrichten, dass sie VDA 5050-konform sind.
Und dann gibt es in der VDA 5050 verschiedene Versionen. Wenn der Roboter die neueste Version noch nicht unterstützt, aber die Plattform das tut, dann wird es schon wieder anspruchsvoll. Und selbst wenn der Hersteller des Roboters sagt, er ist bereit, für diese spezifische VDA 5050-konforme Plattform eine Integration zu machen, dann passiert das nicht einfach so im Handumdrehen. Zwei Tage später sagen wir dann nicht einfach „Wunderbar, es funktioniert“. Es müssen auch Dokumentationen geprüft werden, Tests vom Hersteller, Tests von den Plattformen – die müssen sich zusammensetzen und das integrieren.
Es kann also passieren, dass wir zu einem Kunden gehen und sagen: „Okay, wir müssen uns überlegen, ihr braucht zwei Hersteller. Wollt ihr die mit einer Plattform abdecken? Welche Plattform unterstützt beide Hersteller?“ Es kann sein, dass beide sagen, „Ja, wir haben VDA 5050-Plattformen, wir haben das schon mit dieser Firma gemacht, wir haben das auch schon mit der gemacht.“ Aber die andere Firma hat mit den und den gemacht und da ist keine Schnittmenge dabei. Und dann steht man wieder am Anfang und muss sich überlegen: „Vielleicht ist das gar keine Option, oder wir holen die Plattformbetreiber mit ins Boot und fragen, wer von euch wäre bereit, für diesen Roboter auch noch eine Integration zu machen?“
ANDREA SPIEGEL: Das heißt, da ist auf jeden Fall auch noch viel, ich höre da so ein bisschen „Trial and Error“ raus und viel Überlegung, was der beste Use Case in dem speziellen Fall, in jedem Projekt ist. Also es gibt noch keine, wie du gesagt hast, Blaupause oder eine pauschale Lösung für Standard-Logistik-Prozesse, bei denen du sagst, das funktioniert bei allen?
CHRISTOPH RIXE: Ja, ich würde es nicht „Trial and Error“ nennen, aber ja, es gibt noch keine Blaupause. Man muss sich wirklich individuell anschauen, was der beste Weg ist, und es ist auch sehr viel Dynamik am Markt. Das macht es gerade so spannend für mich, aber auch so anspruchsvoll in den Projekten, weil man noch nicht weiß, welcher Roboter mit welcher Plattform kommunizieren kann. Deshalb kann ich auch nicht sagen, „Mit dieser Plattform kriegt man das auf jeden Fall hin.“ Alle paar Wochen hört man von einer Plattform, dass sie jetzt Hersteller XY an Bord hat und es mit ihrer Plattform über VDA 5050 funktioniert. Man muss einfach immer aktuell bleiben und den Markt im Blick haben, um in einem kundenindividuellen Fall eine gute Empfehlung abzugeben.