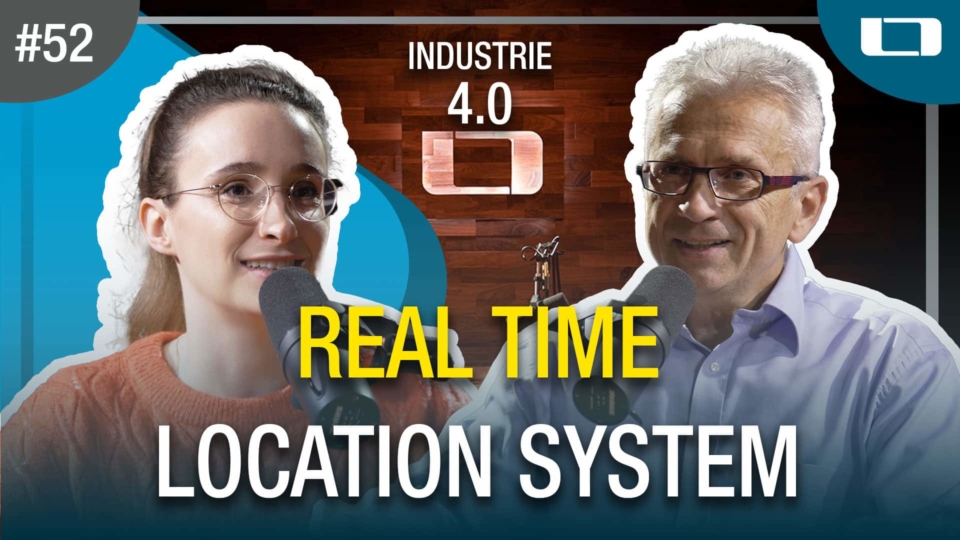ANDREA SPIEGEL: Du hast bereits mehrmals das Thema der Kostenstruktur angesprochen und dass der Return on Investment (ROI) eine Rolle spielt. Könntest du uns einen Überblick darüber geben, welche Faktoren und Aspekte die Kosten beeinflussen und gleichzeitig, wie man sicherstellen kann, dass sich die Investition langfristig auszahlt? Könntest du grob skizzieren, woran man denken muss und welche Kostenpunkte auf einen zukommen?
CHRISTIAN SIEGLE: Sicher, Kosten spielen in mehreren Phasen eine Rolle. Zunächst einmal in der Konzeptphase, in der das Projekt vorbereitet wird. Es ist wichtig, dass Mitarbeiter für dieses Projekt abgestellt werden, da eine sorgfältige Vorbereitung und Planung entscheidend ist. Je besser das Konzept, desto reibungsloser die Umsetzung. Das ist der erste Faktor.
Dann gibt es die Kosten für die Inbetriebnahme. Je größer das System und je mehr Abgabestellen es gibt, desto länger dauert die Inbetriebnahme. Hier müssen Mitarbeiter freigestellt werden, um das System in Zusammenarbeit mit dem Kunden erfolgreich einzurichten.
Hardware-seitig fallen Kosten für die Fahrzeuge und gegebenenfalls für Engineering-Arbeiten an. Manchmal müssen Fahrzeuge modifiziert werden, um spezielle Anforderungen zu erfüllen, wie beispielsweise das Anpassen von Vorrichtungen.
Eine wichtige Überlegung betrifft die Anzahl der Fahrzeuge. Es empfiehlt sich, eine dynamische Simulation durchzuführen, um sicherzustellen, dass das System optimal dimensioniert ist. Das erhöht zwar die Kosten, gewährleistet jedoch, dass das System effizient arbeitet.
Weitere Kostenpunkte sind mögliche Umbauten in der Umgebung, wie Tore, Aufzüge oder spezielle Regalsysteme. Auch Übergabestationen müssen möglicherweise angepasst werden.
Zusätzlich gibt es einmalige Investitionen in Projektmanagement, Beratung, Konzeption und Terminplanung, die berücksichtigt werden müssen.
ANDREA SPIEGEL: Das sind also die Einstiegskosten.
CHRISTIAN SIEGLE: Richtig. Dann gibt es laufende Beratungskosten, die je nach Bedarf anfallen. Das umfasst verschiedene Aspekte des Projekts.
Insgesamt sind das grob zusammengefasst die wichtigsten Kostenfaktoren. Es kann von Projekt zu Projekt unterschiedlich sein. Bei den Einsparpotenzialen ist zu beachten, dass nicht nur Rationalisierungspotenziale zu berücksichtigen sind, sondern auch das Potenzial zur Wertschöpfung. Das bedeutet, dass Mitarbeiter, die durch das System rationalisiert werden, möglicherweise in anderen Bereichen eingesetzt werden können.
Die Zuverlässigkeit steigt, Transportprobleme und Stillstände aufgrund von Materialmangel werden reduziert. Es können auch Instandhaltungskosten gesenkt werden, da automatisierte Systeme weniger anfällig sind. Sicherheitskosten können ebenfalls sinken, da Gefahrenpotenziale reduziert werden.
Es ist wichtig, diese Potenziale individuell für jedes Unternehmen zu bewerten. Zusätzlich können ergonomische Verbesserungen und die Zufriedenheit der Mitarbeiter positive Auswirkungen haben.
ANDREA SPIEGEL: Das bedeutet, es gibt viele Vorteile zu beachten, nicht nur in Bezug auf die Kosten, sondern auch auf die Effizienz und Mitarbeiterzufriedenheit.
CHRISTIAN SIEGLE: Genau, durch solche Systeme können Unternehmen ihre Abläufe optimieren und gleichzeitig die Arbeitszufriedenheit ihrer Mitarbeiter steigern.
ANDREA SPIEGEL: Vielen Dank, dass du uns einen Einblick in den Nutzen, die Wertschöpfung, die Kosten und die Funktionsweise von FTS gegeben hast.