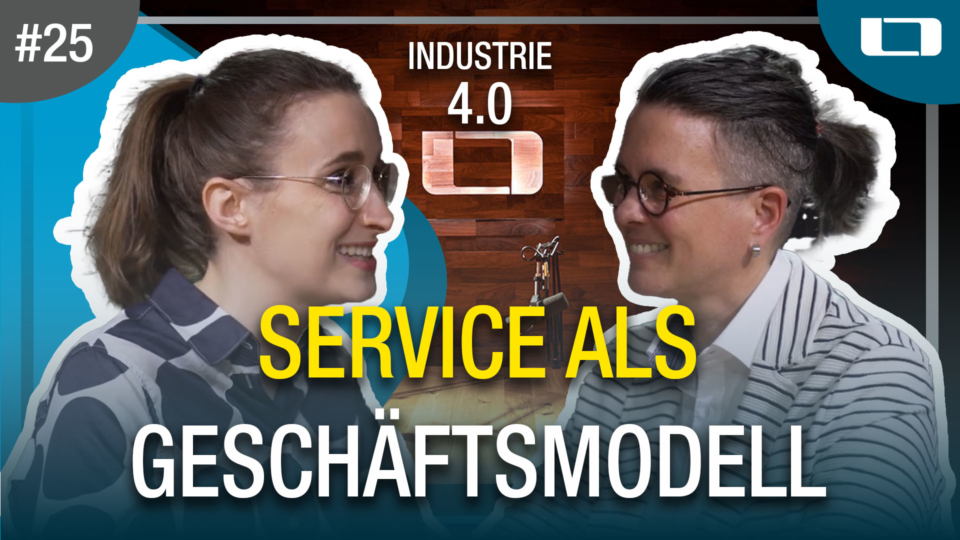ANDREA SPIEGEL: Wir haben jetzt ja schon über einige Use Cases im Bereich AR oder auch Virtual Reality in der Industrie gesprochen. Können wir uns vielleicht noch ein oder zwei davon etwas tiefer anschauen, um zu sehen, welchen Mehrwert sie tatsächlich bieten und wie ich diese möglicherweise auch in meinem Unternehmen implementieren kann? Was muss ich vorbereiten? Welches Wissen muss ich vielleicht aufbauen? Muss ich alles Wissen selbst aufbauen, oder würdest du eher empfehlen, mit Experten von außen zu arbeiten? Wie gehe ich an so ein Thema ran?
PROF. DR.-ING. VOIGT-ANTONS: Ja, genau. Also ich würde sagen, das kommt ganz auf die Zielsetzung an. Wenn man noch nie damit in Kontakt war, bietet es sich natürlich an, eine Technologie erstmal ganz niederschwellig zu beschaffen und auszuprobieren. Man könnte sie auch den Mitarbeitenden im Pausenraum zur Verfügung stellen, um zu sehen, welche Ideen daraus entstehen. Damit wird auch vermieden, dass diese Entscheidung einfach von oben getroffen wird. Für Projekte, die dann durchgeführt werden, ist es besonders zu Beginn hilfreich, wenn die Technologie nicht schon intern verfügbar ist, diese mit Partnern umzusetzen.
Es gibt viele Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, solche Anwendungen gegen Bezahlung zu entwickeln, und natürlich auch Hochschulen. Ich selbst bin ja Wissenschaftler, und wir versuchen, mit Unternehmen aus der Großindustrie sowie dem Mittelstand zusammenzuarbeiten. Man kann gemeinsam auch Forschungsmittel beantragen, sodass die Investitionen nicht nur vom Unternehmen getragen werden müssen, sondern auch von Innovationsprogrammen, die solche Projekte fördern. Ein typisches Vorgehen wäre zum Beispiel, am Anfang eine Aufgabenanalyse durchzuführen, um zu schauen, wie bestimmte Prozesse funktionieren.
Man erhebt also zunächst den Status Quo, um danach zu analysieren, wo man mit der Technologie und den Stakeholdern, die im Technologiebereich tätig sind, sowie den Expertinnen und Experten aus den Unternehmen, gemeinsam spezifische Funktionalitäten, Demonstratoren und Prototypen entwickeln kann.
ANDREA SPIEGEL: Kann man so Mehrwerte schaffen.
PROF. DR.-ING. VOIGT-ANTONS: Genau. Der nächste Schritt wäre dann, diese Prototypen umzusetzen und zu testen. Wir sind immer datengetrieben. Das bedeutet, wir setzen eine Technologie nicht einfach ein, weil sie neu und spannend ist, sondern wir implementieren bestimmte Versionen und testen dann, ob sie einen tatsächlichen Nutzen bringt. Führe ich damit zu einem Performance-Output? Das ist gut für das Unternehmen, aber gleichzeitig muss auch die User Experience stimmen.
ANDREA SPIEGEL: Ergonomie vielleicht.
PROF. DR.-ING. VOIGT-ANTONS: Genau, Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit. Das bedeutet, dass man eine hohe Performance von der Software oder Anwendung hat, während gleichzeitig die benutzende Person eine positive Erfahrung macht.
Und dann hat man erste Daten. Man kann dann zum Beispiel sagen, dass ein bestimmtes Training besser funktioniert, die Mitarbeitenden schneller lernen als auf Papier. Für mich ist es immer wichtig zu betonen, dass eine Technologie nur dann verwendet werden sollte, wenn sie einen echten Nutzen bietet. Wenn die Technologie nur „da ist“, ohne dass sie einen Mehrwert liefert, macht der Einsatz keinen Sinn. Erst wenn man in einer Probephase merkt, dass die Technologie tatsächlich einen Nutzen bringt, sollte man überlegen, wie man weiter verfahren kann.
Man kann dann entscheiden, ob man den Prototyp intern weiterentwickelt, wenn man über die entsprechenden Ressourcen verfügt, oder ob man mit einer externen Programmieragentur zusammenarbeitet, um die Technologie als Produkt weiterzuentwickeln. Für mich ist der partizipative Ansatz, bei dem man mit verschiedenen Stakeholdern zusammenarbeitet, immer der richtige Weg. So kommt die Entscheidung nicht von oben, von unten oder von außen, sondern wird gemeinsam erarbeitet.
Das ist insbesondere im Schulungsbereich sehr wichtig. Ein anderes Beispiel, das mittlerweile oft als Schlagwort verwendet wird, sind digitale Zwillinge. Dabei kommt es darauf an, wie man diese definiert. Ein digitaler Zwilling kann ein einfaches Modell sein, aber auch eine komplexe 3D-Visualisierung. Wir arbeiten in verschiedenen Projekten, von der Visualisierung von freien Parkplätzen bis hin zu Zustandsüberwachungen von Robotern in automatisierten Fabrikhallen, die den Transport von Waren übernehmen. In solchen Projekten müssen wir in Echtzeit bestimmte Zustände in diesen Modellen anpassen.
Es ist spannend, zu sehen, wie wir Daten in Echtzeit erfassen können und wie diese 3D-Modelle, die in Brillen oder auf Displays angezeigt werden, angepasst werden können. Bei digitalen Zwillingen geht es oft darum, wie wir diese Modelle in Echtzeit anpassen können. Man kann die Daten nutzen, um beispielsweise zu überprüfen, ob ein Parkplatz frei oder belegt ist, oder um andere Vorgänge in Echtzeit darzustellen.
ANDREA SPIEGEL: Man möchte ja nicht einfach nur den bestehenden Prozess digital abbilden, wie du vorhin gesagt hast, sondern wir wollen Mehrwert schaffen und etwas Neues kreieren – es besser machen als vorher. Und dafür ist die Technologie dann perfekt. Du hast schon ein paar spannende Beispiele erwähnt, wie zum Beispiel mit den Roboterarmen. Was würdest du sagen, ist das spannendste Projekt, das du bisher in der Industrie begleiten durftest, und warum war das so besonders? Was habt ihr genau gemacht?
PROF. DR.-ING. VOIGT-ANTONS: Das ist natürlich eine gute Frage. Aber ich glaube, das spannendste Projekt, das wir gerade haben, ist das Didi Maus Projekt. Das ist ein EU-Projekt, bei dem Partner aus ganz Europa, sowohl aus der Industrie als auch viele Forschungseinrichtungen, beteiligt sind. Wir beschäftigen uns dort mit verschiedenen Use Cases für digitale Zwillinge und immersive Medien.
Ein interessanter Aspekt dieses Projekts ist, dass wir uns fragen, wie die Automatisierung in diesen Bereichen voranschreiten kann. Welche Anforderungen gibt es an bestimmte Use Cases? Und auch, wie wir über Industrien hinweg eine gewisse Normung entwickeln können. Denn in einem größeren Projekt mit einem Unternehmen ist es relativ schnell klar, welchen Standard man verwendet, welche Software und Schnittstellen genutzt werden.
Aber wenn man ein Konsortium hat, in dem zum Beispiel zehn Unternehmen zusammenarbeiten, dann muss man sicherstellen, dass die unterschiedlichen Datenströme miteinander kommunizieren können. Ein großer Teil dieses Projekts ist es daher, eine breite Grundlage zu schaffen, die dann auch für den Mittelstand genutzt werden kann. Viele Unternehmen werden sich keine eigenen Standards ausdenken, also ist es wichtig, ein gemeinsames Fundament zu entwickeln. Kommunikationsstandards und standardisierte Darstellungsformen für 3D-Modelle gibt es schon, aber wir arbeiten weiter daran, diese Ansätze zu erweitern.