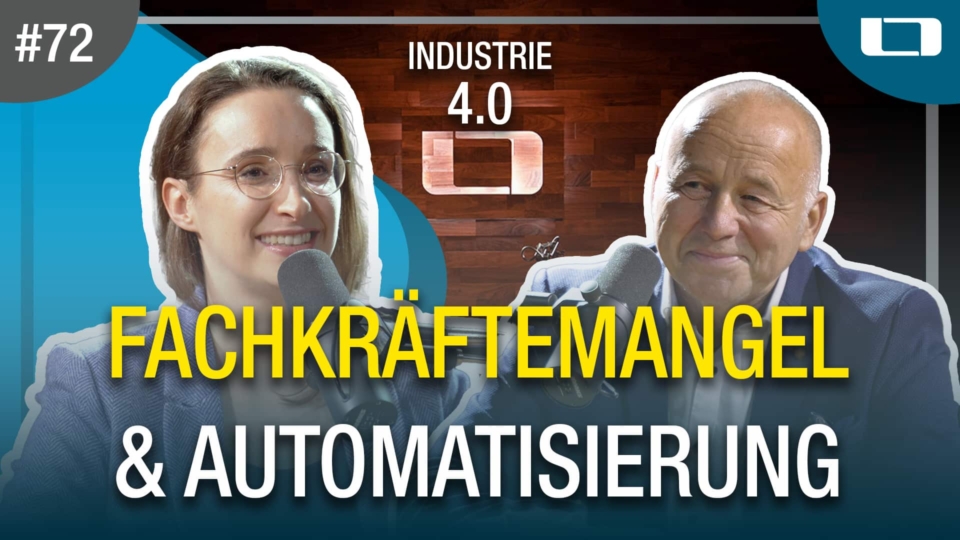ANDREA SPIEGEL: Ich habe mir das Thema ein bisschen angeschaut und gedacht: Gut, was Schichtplanung ist, verstehe ich. Warum man sie braucht, kann ich mir grob denken – auch wenn ich selbst, wie du vorhin beschrieben hast, das Privileg hatte, so etwas noch nie zu erleben. Ich habe immer in Jobs gearbeitet, die eher flexibel waren oder bei denen man sich selbst aussuchen konnte, wann man kommt und geht.
Was sollte man denn darüber wissen, das sich nicht einfach von selbst erschließt, wenn man noch nie so gearbeitet hat? Also: Was sollte man über Schichtplanung wissen und warum lohnt es sich, sich tiefer mit dem Thema zu befassen?
JAN JOSTEN: Zwei Dinge. Man kann das aus der Perspektive der Schichtplanenden und der Schichtgeplanten betrachten.
Fangen wir mit den Schichtplanern an: Sie benötigen für bestimmte Aufgaben zu bestimmten Zeiten eine festgelegte Anzahl an Menschen. Maschinen, Ressourcen und viel Digitalisierung lassen sich in der Supply Chain relativ gut steuern – die benötigten Teile sind in der Regel verfügbar. Das klappt zwar nicht immer, aber hier ist die Varianz meist gering, weil man vieles deterministisch ausrechnen kann.
Mit Menschen ist das deutlich schwieriger: Sie können nicht rund um die Uhr arbeiten, sondern nur zu festgelegten Zeiten. Es gibt gesetzliche Auflagen, Urlaubsansprüche, Krankheitsfälle, Weiterbildungszeiten und individuelle Wünsche. Dadurch ist eine wesentlich flexiblere Planung erforderlich.
Die Schwierigkeit besteht darin, den Personaleinsatz optimal zu planen. In der Praxis passiert oft eines von zwei Dingen: Entweder werden zu viele Leute eingeplant – oder zu wenige. Genau die richtige Anzahl zu finden, ist bei schwankendem Angebot und schwankender Nachfrage extrem schwierig. Die Aufgabe des Schichtplaners ist also, mit derselben Personalressource möglichst viel Arbeitsoutput zu planen, dabei keine Arbeitszeitgesetze zu verletzen und gleichzeitig auf die Wünsche der Mitarbeitenden einzugehen. Das ist eine Herausforderung auf der einen Seite.
Auf der anderen Seite steht die Perspektive der Schichtgeplanten.
Gehen wir einmal die Komplexität durch: In der einfachsten Form gehst du zu einer Schicht, arbeitest acht oder neun Stunden und gehst wieder nach Hause. Wenn aber mehr produziert werden muss – und die Maschinen ohnehin bezahlt sind –, lohnt es sich für den Planenden, die Maschinen stärker auszulasten. Das bedeutet für die Geplanten: Es gibt Früh-, Spät- und Nachtschichten. Wenn das Produktionsvolumen weiter steigt, wird nicht nur an fünf, sondern an sieben Tagen gearbeitet.
Das kann bedeuten, dass in einer Woche 21 Schichten anfallen. Jeder Mitarbeitende kann davon etwa fünf übernehmen. Daraus ergibt sich, dass man mindestens fünf Gruppen braucht, die miteinander rotierend arbeiten.
Früher wurde oft gesagt: „Wir haben eine starre Rotation – diese Woche Frühschicht, nächste Woche Spätschicht, dann Nachtschicht. Wünsche spielen keine Rolle.“
Willst du am Freitag zum Fußballspiel deines Sohnes? Egal.
Willst du am Samstag etwas mit deiner Frau unternehmen? Egal.
Der Schichtplan ist fix, eine Mitsprache gibt es nicht.
Wenn man nun beide Perspektiven zusammenführt, zeigt sich ein Problem: Das Angebot an Mitarbeitenden ist relativ konstant, die Nachfrage schwankt jedoch. Dazu kommt, dass ein starres System unflexibel ist und Frust erzeugt. Vielleicht kommt der Mitarbeiter am Freitag einfach nicht, weil er lieber zum Fußball geht oder sich mit Freunden trifft. Gerade in Zeiten von Arbeits- oder Fachkräftemangel ist es entscheidend, die Mitarbeitenden mitzunehmen – unabhängig von der menschlichen Komponente, die natürlich ebenfalls wichtig ist.
ANDREA SPIEGEL: Ich wollte gerade sagen – die menschliche Seite gibt es auch noch. Aber blenden wir sie kurz aus.
JAN JOSTEN: Genau, ich habe gerade bewusst den abstrakten Blick gewählt.
Man möchte die Mitarbeitenden auch binden und ihnen mehr Flexibilität bieten. In der Forschung beschäftigen wir uns schon lange damit – in Deutschland sogar intensiver als in vielen anderen Ländern. Es geht um die Frage: Wie kann man Schichtplanung flexibler gestalten, auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingehen und gleichzeitig die betrieblichen Anforderungen erfüllen?
Es gibt spannende Konzepte wie Bringschichten, Vorwärts- oder Rückwärtsrotationen, ergonomischere Schichtwechsel und das Arbeiten mit Schichtabsagen. All das sind Möglichkeiten, flexibel auf wechselnden Personalbedarf zu reagieren und den Mitarbeitenden eine Stimme im Prozess zu geben.
Warum wird das heute dennoch kaum umgesetzt? Ganz einfach: Es ist unglaublich aufwendig.
ANDREA SPIEGEL: Ich wollte gerade sagen – das hört sich super anstrengend und kompliziert an.
JAN JOSTEN: Total. Jetzt stell dir vor, du sagst: „Hey, nur zwei Schichten pro Monat.“ Das klingt nach wenig – aber wenn diese zwei Schichten pro Monat, also ein Zehntel aller Schichten, frei koordiniert werden dürfen, bedeutet das: Dort, wo ich jemanden brauche, kann ich sagen, wann. Und du sagst mir: „Ich will am Mittwoch, ich will am Freitag, ich will an einem anderen Tag.“
Hast du 2.000 Mitarbeitende, sind das 4.000 Schichten pro Monat – und fast 50.000 Schichten pro Jahr –, die irgendjemand koordinieren muss. Dabei muss sichergestellt werden, dass genügend Personal da ist und dass diese Personen auch tatsächlich arbeiten dürfen. Ohne ein systemgestütztes Verfahren ist das Wahnsinn.
ANDREA SPIEGEL: Da passieren wahrscheinlich auch Fehler ohne Ende.
JAN JOSTEN: Exakt – Fehler ohne Ende. Das heißt: Die Leute kommen nicht, und die Maschine steht still. Oder sie kommen, obwohl sie gar nicht arbeiten dürfen – Arbeitszeitverletzung inklusive.
ANDREA SPIEGEL: Oder der Falsche ist eingeplant.
JAN JOSTEN: Exakt. Dann hast du zwar jemanden, den du bezahlst, aber der kann den Job nicht machen, weil seine Qualifikationen nicht richtig erfasst wurden. Plötzlich hast du dir große Mühe gegeben, vieles richtig gemacht – und trotzdem einen negativen Return. Die Leute finden es nervig, dein Chef findet es nervig, und am Ende wird doch nicht genug produziert. Aber kein Sternchen vor dem Ergebnis.
ANDREA SPIEGEL: Ein klassisches Los-Los.
JAN JOSTEN: Ja, genau – exakt. Das ist so ein klassisches „Risk-on-Reward“-Thema: sehr hohes Risiko, und der Reward wird von vielen nur darin gesehen, dass die Leute etwas glücklicher sind.
Schaut man sich das aber in der Realität an, kann man Über- und Unterdeckung gezielt nutzen. Man sagt: „Da, wo ich die Leute nicht brauche, lass sie nicht kommen. Da, wo ich sie brauche, sollen sie kommen.“ So kann ich mit den gleichen Mitarbeitenden viel mehr Arbeit schaffen, indem ich diese Kurve ausgleiche. Gleichzeitig sind die Leute zufriedener – und die Produktivität steigt. Eigentlich also ein Win-Win-Potenzial. Man muss nur schaffen, die PS auf die Straße zu bringen.