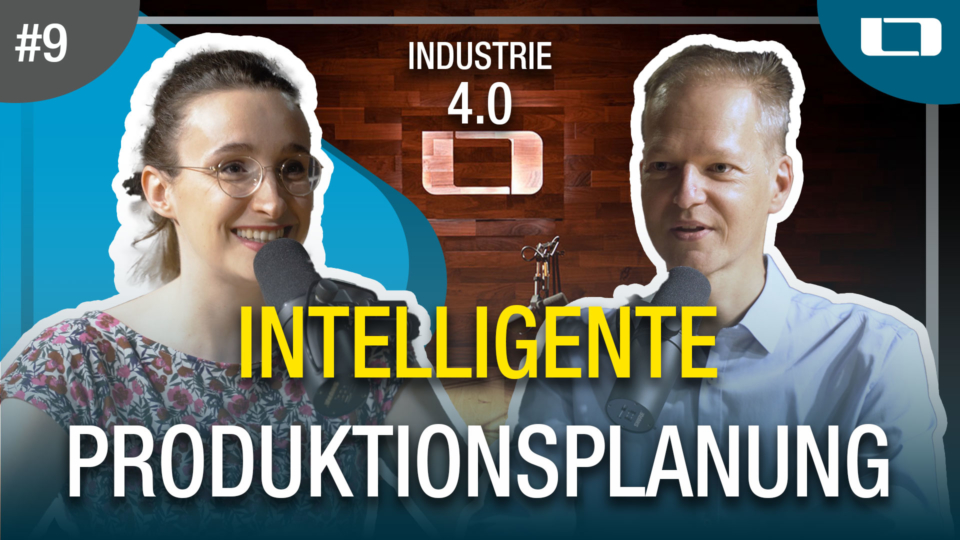ANDREA SPIEGEL: Vielleicht kannst du zum Abschluss mal ein kleines Praxisbeispiel mit uns durchgehen. Erzähl uns einfach, wie die Aufgabenstellung bei einem Unternehmen war, ohne Namen zu nennen, und gib uns einen Einblick: Wie läuft das ab? Was hast du erlebt? Wie muss man sich das vorstellen?
SIMON KALLINGER: Gerne. Ich erzähle es zuerst so, wie es vorher gelaufen ist, und dann, wie es danach aussah. Dann wird das Ganze vielleicht etwas deutlicher. Also: Ein Hersteller in der diskreten Fertigung baute kleine Serien, bis hin zu Einzelstücken auf Kundenauftrag. Am Anfang überlegte man: „Was brauchen wir, um das komplette Bauteil oder das ganze Produkt herzustellen?“ Man packte alle Materialien zusammen, verstaute zwei oder drei Paletten und brachte alles zum ersten Arbeitsgang.
Dann standen dort unzählige Paletten herum – auch Materialien, die erst beim Arbeitsgang 9 gebraucht wurden. Das heißt, man hatte gar keinen Zugriff mehr auf bestimmte Teile, obwohl man sie in einem früheren Arbeitsschritt vielleicht schon hätte verwenden können. Dadurch entstanden enorme Überbestände und Ineffizienzen: In der Produktion fehlte der Platz, man musste alles auseinanderdröseln und suchen.
Dort setzten wir an. Die Idee war: Warum schicken wir alles auf einmal zum Produktionsanfang? Das macht doch keinen Sinn. Man kann die Materialien doch just in time zur richtigen Maschine und zum richtigen Arbeitsgang liefern. In den Workshops haben wir dann intensiv erarbeitet, wie man das stückweise organisiert. Wenn beispielsweise der erste Arbeitsgang abgeschlossen ist, was passiert mit dem Output? Dann ist es ein Halbfabrikat, das vielleicht erst morgen im nächsten Produktionsschritt weiterverarbeitet wird – oder vielleicht braucht es eine andere Maschine, weil ein anderer Kundenauftrag oder eine andere Charge gerade Vorrang hat. Genau hier greift das WMS: Es übernimmt den Transport, entscheidet anhand hinterlegter Strategien und Merkmale, wohin das Material muss, und steuert die komplette Transportkette innerhalb der Produktion.
ANDREA SPIEGEL: Wie sieht es heute bei dem Unternehmen aus? Sind sie super happy oder haben sie schon wieder die nächste Idee, was sie optimieren könnten? Läuft es jetzt einfach besser, weil Just-in-Time das Material dort ist, wo es gebraucht wird, statt alles am Anfang zu horten?
SIMON KALLINGER: Sie konnten ihre Prozesse enorm verbessern. Soweit ich weiß, arbeiten sie inzwischen nach dem Lean-Gedanken, also in kontinuierlicher Verbesserung. Sie streben sogar die „Smart Factory“ an. Nur die reine Verknüpfung von WMS und MES war der erste Schritt – der Weg zur echten Smart Factory ist noch lang. Aktuell befinden sie sich vermutlich im Stadium einer selbstregulierenden Fabrik, einen Schritt davor vielleicht.
ANDREA SPIEGEL: Das ist ja schon etwas.
SIMON KALLINGER: Ja, das ist wirklich super. Der Mensch muss nur noch bei außergewöhnlichen Ereignissen eingreifen, etwa wenn Material ausgeht oder ein unerwarteter Maschinenausfall passiert. In allen anderen Fällen regeln die Systeme eigenständig über die Schnittstelle, und es ist kein manuelles Eingreifen nötig. So bleibt die wertvolle Ressource Mensch frei für Optimierungen und strategisches Denken.
ANDREA SPIEGEL: Genau, um an den Prozessen zu arbeiten, nicht in den Prozessen.
SIMON KALLINGER: Ganz genau.
ANDREA SPIEGEL: Hast du noch einen Tipp, wo so ein Projekt idealerweise angestoßen wird? Ist das eine klassische Top-Down-Entscheidung, weil große Unternehmensbereiche betroffen sind – Produktion und Lager? Oder kommt der Impuls eher von der Mannschaft, weil sie merkt, dass es besser laufen muss?
SIMON KALLINGER: Wo es angestoßen wird, ist fast egal. Wenn es Top-Down kommt, ist das Budget meist gesichert. Wenn es Bottom-Up initiiert wird, braucht man gute Argumente, um die Unternehmensführung zu überzeugen. Ein solches Projekt ist ein großer Invest, daher ist es wichtig, dass das Management das Potenzial erkennt. Es ist der erste Schritt, und die Reise muss weitergehen. Man braucht ein klares Bekenntnis, dass man es wirklich umsetzen will, inklusive Budget und den notwendigen Ressourcen – und dann kann es losgehen.
ANDREA SPIEGEL: Also zuerst den Kopf frei machen: aktiv entscheiden, dahinterstehen, Budget und Personal bereitstellen – dann hat man eine gute Voraussetzung.
SIMON KALLINGER: Genau, so fühlt man sich sicherer.
ANDREA SPIEGEL: Siehst du am Horizont in den nächsten fünf bis zehn Jahren spannende Entwicklungen rund um WMS-MES-Verknüpfungen?
SIMON KALLINGER: Da schlummern noch riesige Potenziale. Viele Unternehmen haben das noch nicht entdeckt, und es gibt nur wenige umgesetzte Projekte. Ich erwarte, dass sich Partnerschaften, Kooperationen und Standards entwickeln. Dann wird es auch wirtschaftlich attraktiver und einfacher zu implementieren.
Technologisch sind wir schon auf einem guten Stand, und Logistikanbieter nutzen bereits intelligente Algorithmen. Wenn man über Smart Factory spricht, wird Künstliche Intelligenz sicher noch einen großen Mehrwert bringen.
ANDREA SPIEGEL: Siehst du einen Trend, dass Anbieter ein kombiniertes MES-WMS anbieten?
SIMON KALLINGER: Das kann Sinn machen. Es hängt davon ab, wie sich ein Systemhaus entwickeln möchte. Ein WMS mit jahrzehntelanger Historie komplett neu zu entwickeln, wäre aufwendig. Aber es wäre wünschenswert.
ANDREA SPIEGEL: Würdest du nicht Nein sagen, wenn es das gäbe?
SIMON KALLINGER: Nein, natürlich nicht. Es gibt bereits Systemhäuser, die ein WMS entwickelt haben, obwohl sie ursprünglich keine WMS-Anbieter waren. Diese Anbieter können mittlerweile mit etablierten WMS-Lösungen mithalten.