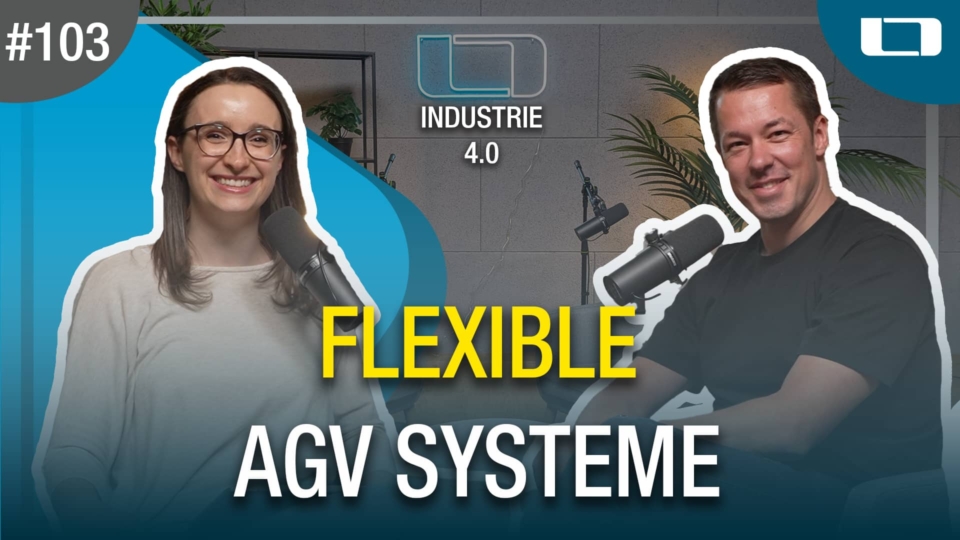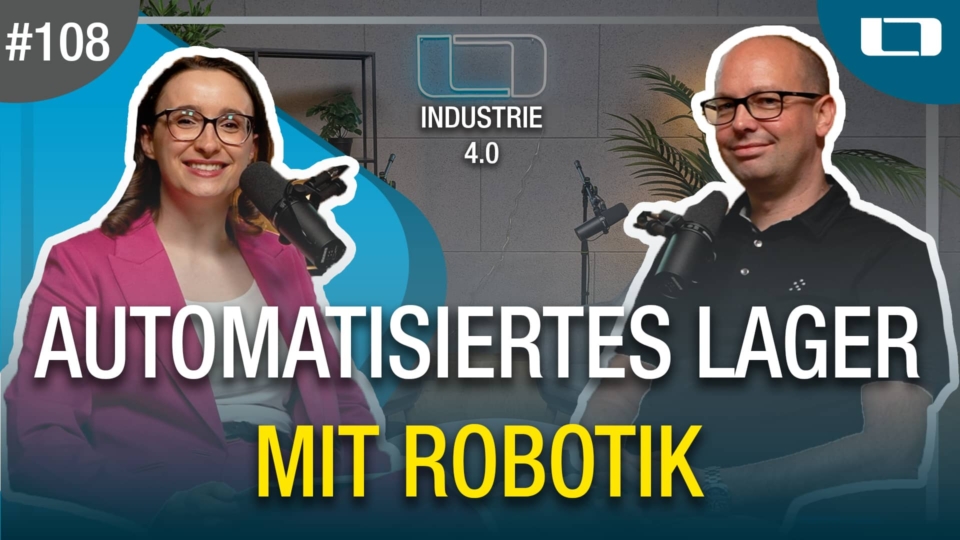ANDREA SPIEGEL: Was sind denn die Use Cases? Und für welchen Use Case eignet sich welches Gerät eher?
MARKUS ZIPPER: Unsere Erfahrung zeigt: Je größer die Flotte, desto weniger Autonomie kann ich zulassen, weil wir sonst im Chaos versinken. Wenn ich sehr getaktete Prozesse habe – also eine hohe Fahrtfrequenz, Maschinen, die ich fahren und zurückbringen muss – und genau wissen muss, zu welcher Minute etwas wo sein muss, dann ist ein autonomes Fahrzeug eher ungeeignet. Die Planung wird schwieriger, weil das Fahrzeug Entscheidungen trifft, die ich nicht exakt vorhersagen kann. Bei kleineren Flotten oder sich ändernden Umgebungsbedingungen – zum Beispiel auf einer sehr flexiblen Logistikfläche, auf der Paletten mal hier, mal da stehen – bringt die Autonomie Vorteile.
ANDREA SPIEGEL: Der Roboter ist dann einfach flexibler, kann Hindernissen ausweichen, ist aber nicht so zuverlässig zeitlich.
MARKUS ZIPPER: Genau. Man muss vorher simulieren, was später in der Anlage passiert. Wenn hohe Leistung und Verfügbarkeit gefordert sind, tendiert man eher dazu, autonome Geräte nicht einzusetzen.
ANDREA SPIEGEL: Kann man auch beide kombinieren? Zum Beispiel: Für bestimmte Fahrten nutze ich das klassische AGV oder FTF, das planbar ist, und in einem anderen Bereich lasse ich das Fahrzeug autonom fahren.
MARKUS ZIPPER: Ja, das geht. Es gibt Systeme, die beides zulassen. In einem Bereich kann ich Autonomie wählen, in einem anderen nicht. So kann ich die Vorteile beider Systeme in einem Gesamtsystem nutzen.
ANDREA SPIEGEL: Kannst du noch einmal zusammenfassen: Welche Auswirkungen hat meine Wahl auf meine Flexibilität? Wenn sich Prozesse ändern oder etwas Neues hinzukommt, welchen Einfluss hat das auf die Entscheidung?
MARKUS ZIPPER: Wenn ich weiß, dass meine Umgebung sehr flexibel ist – Maschinen werden ständig umgestellt, Ware muss zwischengelagert werden –, dann muss ich überlegen, ob ein autonomes Fahrzeug sinnvoll ist. Nachteile sind zum Beispiel, dass man die Performance der Anlage im Vorhinein nur schwer simulieren kann. Die Autonomie erzeugt gewisse Zufälle, etwa Staus von Fahrzeugen. Wir sehen, dass in vielen Fällen Autonomie nicht geeignet ist, in speziellen Fällen aber enorme Vorteile bringt. Genau das analysieren wir bei der Kundenberatung: Was ist sinnvoll? Autonomie klingt zunächst schick – wie ein Staubsauger- oder Rasenroboter zu Hause – aber in der Logistik und Produktion gibt es Menschen, die mit den Fahrzeugen interagieren müssen. Wenn man nicht weiß, wie sich das Gerät verhält, wird die Zusammenarbeit schwieriger – gerade bei Mischverkehr mit Staplern oder Schleppzügen.
ANDREA SPIEGEL: Dann bleibt’s stehen oder so ähnlich.